 Am 12. April erscheint eine Neuausgabe von Carroll Ballards Der schwarze Hengst (The Black Stallion, 1979) zusammen mit seiner Fortsetzung, Der schwarze Hengst kehrt zurück, bei Capelight als DVD- bzw. Blu-ray-Softbox im Schuber. Anlässlich dieser Neuveröffentlichung habe ich mir ausführlichere Gedanken zu Ballards Film gemacht.
Am 12. April erscheint eine Neuausgabe von Carroll Ballards Der schwarze Hengst (The Black Stallion, 1979) zusammen mit seiner Fortsetzung, Der schwarze Hengst kehrt zurück, bei Capelight als DVD- bzw. Blu-ray-Softbox im Schuber. Anlässlich dieser Neuveröffentlichung habe ich mir ausführlichere Gedanken zu Ballards Film gemacht.
Eigentlich, hat der Kritiker Carson Lund vor einigen Jahren über Der schwarze Hengst (The Black Stallion, 1979) geschrieben, könnte der Film von Carroll Ballard genauso gut ein Stummfilm sein. Das bedeutet keineswegs, dass der Ton in diesem Film keine Rolle spiele – aber es betont eben doch die spürbarsten, deutlichsten Stärken: Die großartigen Aufnahmen von Mensch und Tier, die Naturbilder von Sardinien, die Unterwassersequenzen – und schließlich, in den letzten 15 Minuten des Films, die meisterhaft rhythmischen Filmsequenzen, ständig alternierend, die Perspektive wechselnd und so die Spannung nur antreibend, im großen Rennen zwischen dem Protagonisten und seinem Pferd und den zwei schnellsten Pferden Amerikas.
Wo kann ich diesen Film streamen? (Käufe über diese Links bringen mir über einen Affiliate-Deal ein wenig Geld.)
Doch der Reihe nach: Wir schreiben das Jahr 1946, das Dampfschiff „Drake“ schippert an der Küste Nordafrikas entlang. Der junge Alec Ramsey (Kelly Reno) ist mit seinem Vater (Hoyt Axton) unterwegs, der sich die Tage auf dem Schiff anscheinend mit Kartenspielen vertreibt. Alec schaut sich derweil auf der „Drake“ um und sieht, wie ein wildes, schwarzes Pferd mehr schlecht als recht in einer Kabine untergebracht wird; später legt er dem immer noch unruhigen Tier einige Zuckerwürfel ins offene Fenster, bis dessen Besitzer ihn verjagt und vor dem Pferd warnt: „Shaitan“, „Teufel“, flüstert er ihm zu.
Alecs Vater hatte Glück im Spiel und überlässt seinem Sohn von dem Gewinn – ein buntes Durcheinander von Münzen und anderen Wertgegenständen – ein Taschenmesser sowie eine kleine Pferdefigur aus Metall. Dabei handele es sich, erzählt er ihm, um Bucephalus, den schwarzen Hengst Alexanders des Großen – ein wildes Pferd, das niemand bändigen konnte, bis Alexander, damals noch ein Junge wie Alec, kam und es zähmte.
Der schwarze Hengst nimmt dann eine jähe Wendung; in der Nacht gerät die „Drake“ in Seenot; inmitten großer Panik kann sein Vater ihn noch nach draußen bringen, aber dann kommt eins zum anderen, und plötzlich findet Alec sich allein neben dem sinkenden Schiff wieder, von seinem Vater keine Spur. Der schwarze Hengst, der sich gerade rechtzeitig noch losreißen konnte, ist das einzig sichtbare Lebewesen in seiner Nähe; Alec greift sich eines der Seile, mit denen das Tier festgebunden war, und wird hinter ihm hergezogen.
Der Untergang der „Drake“ ist die vielleicht unruhigste, nervöseste Sequenz des Films. Gedreht in einem riesigen Wasserbecken in den Cinecittà-Studios bei Rom, mit versinkendem Modellschiff und schwimmendem Pferd, die Kamera von Caleb Deschanel wechselt zwischen Ansichten über und unter Wasser: Strampelnde Beine von Kind und Pferd, das brennende Wrack immer im Hintergrund. Das Chaos der Katastrophe wird da auch in den ungeordneten, beweglichen, fast hektischen Bildern, den wechselnden Blickrichtungen eingefangen: Alecs Orientierungslosigkeit setzt sich unmittelbar auch ins Publikum fort.
Und zugleich läutet der Film so den Wechsel ein zu der Zeit, in der er sich nahezu ganz auf seine Bilder verlässt – und, meine Güte, was für Bilder! Alec findet sich, mit nichts als seinem Schlafanzug, dem Taschenmesser und der Bucephalus-Figur, an einem einsamen Strand wieder, vielleicht auf einer Insel – karg, ohne viel Vegetation. Ebenfalls dort: das schwarze Pferd. Und natürlich werden sich – Bucephalus lässt grüßen – Kind und Pferd einander annähern, Vertrauen zueinander fassen.

Aber Ballard hat es weder eilig, noch möchte er diese Annäherung als Klischee inszenieren. Stattdessen gibt er uns viel Zeit, Deschanels Bilder zu genießen, weitgehend ohne künstliche Lichtquellen auf Sardinien gedreht. Wunderschöne, von Wasser und Wind abgerundete Felsen; weite Blicke über von der untergehenden Sonne bestrahlte Wellen und Strände; die im Wind flatternde Mähne des wilden Pferdes; tiefblaues Meer und gelb-rote Steine. Da ist ein Bild schöner als das andere, sie sind zugleich alles andere als Selbstzweck, sondern verankern die Figuren in ihrer Umgebung, begleiten anschließend die ersten Begegnungen zwischen Kind und Tier – wenn Alec zum Beispiel vorsichtig um einen Felsen geht und im Hintergrund das wilde Tier zu sehen ist: Tobend, weil sich die Seile verhakt haben.
Wie gekonnt die Bilder dazu dienen, die Beziehung zwischen den beiden zu beschreiben, zeigt sich später bei einer ersten echten Begegnung. Zuerst bietet Alec dem Pferd etwas Seetang an, den er im leeren Panzer einer Schildkröte bereitgelegt hat. Anschließend aber hält er das salzige Grün direkt in der Hand und lockt damit. Dieser Versuch – zuerst nicht wirklich erfolgreich, dann aber eben doch, drei Pferdeschritte vor, zwei zurück – ist in einer einzigen, ungeschnittenen Sequenz zu sehen, aus der Distanz beobachtet. Folgte der Kontakt vorher noch dem filmischen Prinzip Schuss-Gegenschuss, so lässt die Kamera den beiden hier Zeit, aufeinander zuzugehen. Überzeugender und präziser ließe sich das nicht einfangen.

*
Wer die Vorlage kennt, Walter Farleys Jugendbuch Blitz, der schwarze Hengst (im Original ebenfalls The Black Stallion) von 1941, fällt zudem spätestens während dieser Begegnung auf, wie geschickt einzelne Elemente aus dem Buch (eben zum Beispiel die Verwendung des Schildkrötenpanzers) in den Film integriert sind, ohne dass ihr Auftauchen genauer beschrieben wird. Denn das Drehbuch von Melissa Mathison, Jeanne Rosenberg und William D. Wittliff nimmt sich sowieso einige Freiheiten: Zum Beispiel ist Alec im Buch allein auf der „Drake“ unterwegs, nachdem er seinen Onkel in Indien besucht hatte – sein Vater kommt deshalb natürlich auch nicht bei dem Schiffsunglück ums Leben.
Vor allem aber ist die Geschichte davon, wie Alec und „der Schwarze“, wie er das Pferd bald nennt, sich einander annähern, im Buch naturgemäß eine wortreiche Angelegenheit, die allerdings nur wenige Kapitel dauert. Im Film nimmt die Zeit auf der Insel zusammen mit der Zeit auf dem Schiff fast die Hälfte der knapp zweistündigen Laufzeit ein – und kommt ohne ein einziges gesprochenes Wort aus. Eine gute halbe Stunde lang sind nur Geräusche, Wiehern und Filmmusik zu hören sind. Da ist sie spürbar, die Kraft des Stummfilms.
Die Filmmusik, die natürlich keineswegs bedeutungslos ist, sondern die emotionalen Bewegungen des Films präzise nachzeichnet, ohne sich in den Vordergrund zu drängen (im Gegenteil, zuweilen verschwindet sie fast in die Unhörbarkeit) stammt von Carmine Coppola, dem Vater von Francis Ford Coppola, der Der schwarze Hengst als Ausführender Produzent begleitet und umgesetzt hatte – und unter anderem auch seinen Freund Carroll Ballard zum ersten Mal in einen Regiestuhl befördert hatte.
Für den großen amerikanischen Filmkritiker Roger Ebert war die erste Hälfte des Films „so wunderbar atemberaubend, dass die zweite Hälfte, die mit all den eher konventionellen Aufregungen, wie reine Routine erscheint. Wir haben diese zweite Hälfte schon mal gesehen – die Geschichte von dem Kind, dem Pferd, dem alten Trainer und dem großen Rennen.“
Selbst wenn Ebert es sich mit diesem Urteil ein wenig einfach macht – in der Tat ist im Verhältnis zu den wortlosen Glücksmomenten zuvor all das, was nach Alecs Rettung passiert, eher konventionell. Was aber nicht bedeutet, dass Deschanel keine schönen Bilder mehr dafür findet. Direkt nach der Ankunft bricht der Schwarze, von einem Müllmann überrascht und aufgescheucht, den er als Gefahr empfindet, aus Alecs Garten auf und läuft und läuft – das beginnt fast als Slapstick-Szenerie in einer sehr amerikanischen Kleinstadt, mit rollendem Gemüse und überforderten Autofahrern (und auch die Filmmusik kann sich da kleine Anspielungen nicht verkneifen), aber dann galoppiert das Pferd über ein weites Feld, und im Hintergrund, vor der untergehenden Sonne, erheben sich große Industrieanlagen.
Wie könnte man die Differenz zwischen der Insel dort und Amerika hier schärfer visuell einfangen?
*
Der Schwarze wird freilich nicht zwischen Schloten grasen müssen; er sucht sich gewissermaßen selbst ein neues Zuhause. Henry Dailey fängt ihn ein, ein wenig abgehalfteter Ex-Jockey, der mit seiner eigenen Farm nichts so richtig auf die Reihe bekam. Aber er hat Platz für ein Pferd, und mit Alec, der ihm sehr selbstbewusst gegenübertritt, freundet er sich auch schnell an.
Henry wird von Mickey Rooney verkörpert, der in Der schwarze Hengst nach längerer Zeit wieder eine große (und von der Kritik sehr gelobte) Rolle spielen konnte; vor allem aber spielte er eine Rolle, die ihm selbst vertraut war. „Ich habe in vielen Filmen Jockeys gespielt und hatte immer einen guten Draht zu den Pferden,“ berichtete er viele Jahre später in einem Interview. „Deshalb habe ich mich auch in diesem Film wohlgefühlt. … Ich glaube, es ist einer der besten Filme, die ich je gemacht habe.“

In der Tat hatte Rooney vorher schon viermal Rennpferde über die Leinwand geritten; am bekanntesten war vermutlich seine Rolle in Kleines Mädchen, großes Herz (National Velvet, 1944) von Clarence Brown. Dort spielte er, selbst gerade mal knapp 24 Jahre alt, schon einen Ex-Jockey, der der sehr jungen Elizabeth Taylor in ihrer ersten Hauptrolle zeigt, wie sie mit ihrem ungestümen Pferd „Pi“ ein wichtiges Rennen gewinnen kann. Gewisse Parallelen zur Story von Der schwarze Hengst sind da unübersehbar und fielen natürlich auch der zeitgenössischen Filmkritik ins Auge, zumal der Film selbst einen klaren Bezug zu Kleines Mädchen, großes Herz aufmacht: In einer Szene sind Erinnerungsstücke an Henrys aktive Sportlerzeit zu sehen, darunter auch ein Foto, das ihn im Kontext des älteren Films zu zeigen scheint.
Rooney im Wechselspiel mit Kelly Reno zu beobachten, der kleine, kräftige Mann mit dem offenen Gesicht und der sommersprossige Junge mit den großen Augen, ist eine der großen Freuden in dieser zweiten Hälfte des Films; vielleicht noch beeindruckender, wenn auch nur in wenigen Szenen wirklich prominent zu sehen, ist Teri Garr als Alecs Mutter, in deren Gesicht sich alle Sorgen und Gedanken ablesen lassen. Die Freude über den wiedergefundenen Sohn, die Angst, ihn womöglich verlieren zu können. Eine Mutter, die deshalb ihren Sohn eigentlich nicht bei einem Rennen mitlaufen lassen will.
(Leider völlig verschwendet ist übrigens der große Clarence Muse, der mit fast 90 Jahren seine letzte Filmrolle als Henrys Freund Snoe und nur ein paar kurze Auftritte als weiser Schwarzer Mann hat.)

So sehr die erste Hälfte von Der schwarze Hengst sich in seinen wortlosen Bildern fast einer traumgleichen Logik hingibt, so sehr gelingt es der zweiten Hälfte, fast schon realistisch daherzukommen. Viele Handlungsschritte, die im Kontext von Farleys Roman doch sehr weit hergeholt wirken, werden im Film verändert oder ganz umgangen; und dies funktioniert in den allermeisten Fällen zugunsten der Glaubwürdigkeit. Dazu trägt Garrs Spiel wesentlich bei, denn ihre Sorge und widerstrebende Nachgiebigkeit sind wesentlich überzeugender als die nur sehr seltsam aufgelöste, langanhaltende Scharade, die im Buch von Henry und Alec mit dessen Eltern gespielt wird.
Am Ende des Films steht dann natürlich das Rennen, bei dem die beiden bisher schnellsten Pferde Amerikas um die Wette laufen; neben ihnen ein geheim gehaltener Kandidat, der Schwarze, geritten von Alec selbst. Glaubwürdig muss man das alles nicht finden, der „suspension of disbelief“ muss man sich schon hingeben wollen. Die Bilder machen es uns leicht.
Für Caleb Deschanel war dieser Film der Startpunkt für eine große Karriere. Er wurde mehrfach für seine Kameraarbeit bei diesem Film ausgezeichnet und arbeitete später als Kameramann unter anderem bei Der Stoff, aus dem die Helden sind (The Right Stuff, 1983), Der Patriot (The Patriot, 2000), Killer Joe (2011) und Jack Reacher (2012) mit. Das abschließende Rennen von Der schwarze Hengst macht – wenn es die erste Hälfte des Films nicht schon in die Netzhäute gebrannt hat – noch einmal überdeutlich, wie gekonnt Deschanel die Zuschauer auf die Rennbahn bringt… und Robert Dalvas Schnitt macht die atemberaubende Bilderfolge perfekt.
In der Vorbereitung des Rennens, als die Tiere nervös umeinander tänzeln, wechselt die Kamera wieder zügig Perspektiven und Richtungen; sobald aber der Lauf beginnt, zieht die Dynamik der Bilder immer in eine Richtung, mit den Pferden: Hinter ihnen her, neben ihnen; sich den führenden zwei von hinten nähernd. In einer atemberaubenden, kurzen Sequenz scheint der Schwarze in der Bildmitte festzustehen wie eine bewegte Statue, während die Welt, die Rennbahn unter und hinter ihm davonzieht. Dazu schweigt die Filmmusik, nur ein langsam anschwellender Ton ist zu hören, der irgendwann, als die Realität langsam wieder in die Bilder kriecht, nahtlos in Jubel übergeht.

Die Bilder rufen da, zuerst nur durch ihre Aufteilung, die Sequenzen aus der ersten Filmhälfte wieder auf, in denen Alec und der Schwarze über den Strand von Sardinien galoppieren; wenig später werden sich im Finale des Rennens diese Bilder – als Traum, Erinnerung, Überlagerung? – wieder ganz konkret auf die Leinwand schummeln.
*
Dem Vernehmen nach gab es wohl eine gewisse Skepsis, ob dieser „Arthouse-Kinderfilm“ überhaupt sein Publikum finden würde – und man hat es vermutlich dem Standing und Einfluss Francis Ford Coppolas zu verdanken, dass der Film so und überhaupt entstehen konnte. Mit einem Budget von 2,7 Millionen US-Dollar (wobei sich auch Quellen finden, nach denen die Kosten während der Produktion auf 5 Millionen gestiegen seien) war er für einen Film dieser Art auch nicht eben billig.
Der schwarze Hengst wurde dann allerdings ein Riesenerfolg und brachte fast 38 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Am Ende des Jahres 1979 stand er auf Platz 20 der Box-Office-Liste – in einem Jahr, in dem Coppola selbst dem Film mit Apocalypse Now Konkurrenz gemacht hatte und außerdem Blockbuster wie Star Trek – Der Film (Star Trek: The Motion Picture), Rocky 2 und Alien anliefen, ist das keine geringe Leistung.

Auch wenn das Kino seinerzeit noch nicht so unter Sequelitis litt wie heute, ließ doch die Fortsetzung nicht allzu lange auf sich warten – 1983 inszenierte Robert Dalva (der im ersten Film noch den Schnitt verantwortet hatte) Der schwarze Hengst kehrt zurück (The Black Stallion Returns), Kamera führte nun Carlo Di Palma, der später viel mit Woody Allen arbeiten würde. Kelly Reno konnte für diesen Film seine Rolle als Alec noch einmal aufnehmen; seine Karriere als Schauspieler wurde leider 1985 durch einen Unfall abrupt beendet, bei dem er schwere Verletzungen davontrug.
*
Eine Frage wird im Film allerdings nicht wirklich überzeugend beantwortet: Was treibt Alec eigentlich dazu, mit seinem Pferd bei diesem Rennen anzutreten? Im Buch ergibt sich dies nahezu organisch aus der Wildheit des Pferdes, aus seiner für alle sofort sichtbaren, spürbaren Geschwindigkeit – da kann er nicht widerstehen, der sehr amerikanische Junge der 1940er Jahre.
Dafür wirkt allerdings Renos Alec zu zurückgenommen, zu wenig enthusiastisch; eigentlich müsste es ihm reichen, bei seinem Pferd zu sein, mit ihm gemeinsam die Welt zu erleben – und zwar möglichst außerhalb der Städte.
Die Szenerie am Anfang ist eigenartig – das Kartenspiel des Vaters in einer engen, dunklen Kajüte des Schiffes, seine offensichtliche Gier wirkt abstoßend (und scheint auch gar nicht zu dem bürgerlich-braven Haus zu passen, in dem wir später Alec und seine Mutter sehen). Das Schiffsunglück wirkt deshalb wie eine doppelte Befreiung: Für den Schwarzen aus bedrohlicher Gefangenschaft (sein arabischer Besitzer wird, da bedient der Film ganz ungeniert bösartige Stereotype, als durch und durch verwerflich markiert, als er während des Unglücks versucht, Alecs Schwimmweste für sich zu stehlen), für Alec aus den Beschränkungen des Lebens in Zivilisation und Gewinnstreben.
Die Freiheit auf der Insel hingegen ist im Film absolut, geradezu vorsprachlich – und auch weitgehend aller Probleme und Sorgen beraubt, die Farley in seinem Buch noch beschreibt: Woher nehme ich Schutz und Wärme, woher Nahrung? Und so ist es auch nur konsequent, dass Alec im Film nach seiner Rückkehr mit allem fremdelt: Mit den vielen Menschen, mit den Annehmlichkeiten des Badezimmers.
Das ist eine politisch durchaus ambivalente Zurück-zur-Natur-Tonlage, die da anklingt, und die Bucephalus-Geschichte (die im Buch nicht vorkommt), scheint Alecs Schicksal auch noch auf eine andere, mythische Ebene ziehen zu wollen. Da die kleine Metallfigur im Film immer wieder prominent zu sehen ist, ihre Bedeutung für Alec als Erinnerung an seinen Vater ausführlich diskutiert wird, ist es nicht so weit hergeholt, den direkten Vergleich, den Alecs Vater, die Namensgleichheit kommt da nicht einmal richtig vor, mit Alexander dem Großen angestellt hat (sinngemäß: Noch ein Junge – genau wie du!) auf den gesamten Film drehen zu wollen.
Aber eine detaillierte, konsequente Deutung hin zum Mythos gibt der Film dann eben doch nicht her, dafür sind die Ansatzpunkte zu vage und zu locker verstreut. Stattdessen ist es womöglich überzeugender, die betörenden Bilder dieses „Arthouse-Kinderfilms“ (von solchen bräuchte die Welt noch mehr) so zu verstehen, dass Ballards Film uns in eine Welt jenseits des Mammons, des Wettbewerbs und Wettkampfs locken will – dahin, wo es nicht um Leistung, Konsum und Besitz geht. Diese Welt wäre dann vielleicht da zu finden, wo wir uns mit unseren Blicken, unseren Sinnen ganz auf die natürliche Welt um uns herum einlassen, den Tieren unsere Hand entgegenstrecken.
Das ist natürlich eine schöne, etwas einfache und vereinfachende Sicht auf die Welt; aber für einige Zeit möchte man sich doch gerne in ihr aufhalten. Und wenn die Natur sich nicht so freundlich zeigt, gibt es ja wenigstens, als kleiner, nicht immer mangelhafter Ersatz, den Zauber des Kinos.
(Fotos: Capelight)
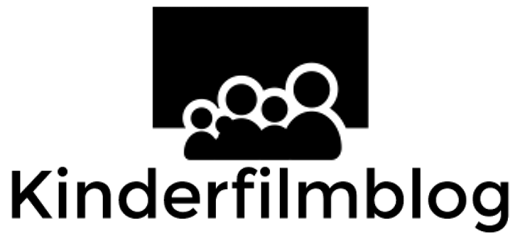



Pingback: Prinzen der Wüste – Schneller als der Wind (2023) – Kinderfilmblog